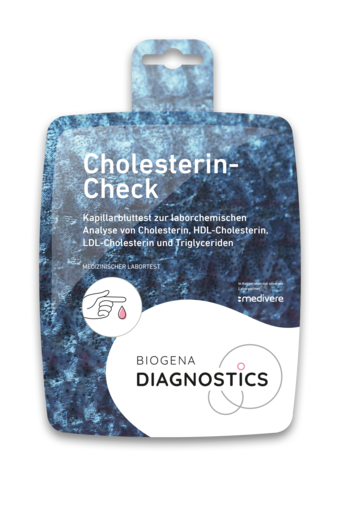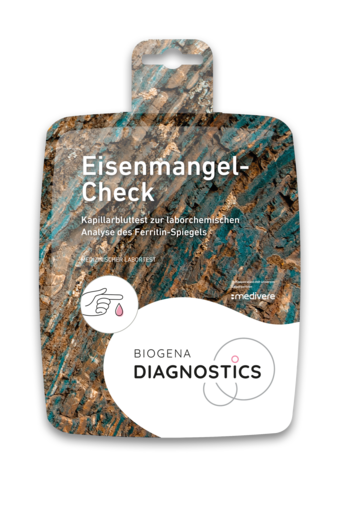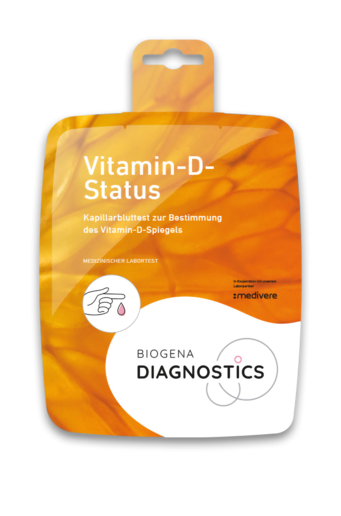Bluttests
Ein einziger Bluttropfen kann viel über unsere Gesundheit verraten. Er ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren (noch bevor sie uns unser Körper kundtut) und eine geeignete Vorsorge.





Blutanalysen durch BIOGENA Ärzt:innen & Therpeut:innen
Bei unseren BIOGENA Diagnostic Partner können Sie entweder spezielle Parameter näher betrachten oder umfangreiche Analysen durchführen lassen - begleitet von medizinischen Fachkräften.
Selbsttests für Zuhause – so einfach geht’s!
Einfach, schnell und sicher: Mit den unkomplizierten Selbsttests finden Sie einen möglichen Optimierungsbedarf ganz einfach und bequem zu Hause selbst heraus.
Nutzen auch Sie den wertvollen Wissensschatz des roten Lebenselixiers. Biogena bietet dafür spezielle und unkomplizierte medizinische Labortests für zu Hause. Ohne Arzttermin können diese bequem selbst durchgeführt werden. Sie beleuchten ausgewählte Facetten Ihrer Gesundheit und zeigen einen möglichen Optimierungsbedarf auf.
Für den Selbsttest werden mithilfe einer Lanzette wenige Blutstropfen aus der Fingerspitze (man spricht von Kapillarblut) entnommen und je nach Test in ein Blutentnahmeröhrchen oder auf eine Trockenblutkarte getropft. Diese Probe wird per Post an ein akkreditiertes Diagnostik-Fachlabor geschickt. Bereits nach wenigen Tagen erhalten Sie das Ergebnis – übersichtlich und selbsterklärend – per Post oder auf Wunsch online.
Die Biogena-Kapillarbluttests im Überblick:
Eisenmangel-Check
Die Versorgungslage mit dem Spurenelement Eisen hat nach wie vor weltweite Relevanz. Allen voran werdende Mütter, prämenopausale Frauen, Kinder, Menschen mit einer streng pflanzlichen Ernährung oder mit bestimmten Erkrankungen und ambitionierte Ausdauersportler sollten ihren Eisenhaushalt im Auge behalten. Wie ist es um Ihren momentanen Eisenspiegel bestellt? Sie sind einen Blutstropfen von einer Antwort entfernt. Mit dem Eisenmangel-Check von Biogena erhalten Sie eine detaillierte Auswertung Ihrer individuellen Eisenversorgung, übersichtlich und selbsterklärend aufbereitet.
Cholesterin-Check
Cholesterin ist für uns Menschen ein unglaublich wichtiger Stoff – lebenswichtig sogar. Ein Überschuss des fettartigen Stoffs kann jedoch auf Herz und Gefäßen lasten. Wie sehen Ihre Cholesterinwerte in Detail aus? Der Cholesterin-Check von Biogena fühlt dieser Frage genauer auf den Zahn. Mit dem Selbsttest „Cholesterin-Check“ erhalten Sie eine detaillierte Auswertung der Fettstoffwechsel-Parameter Gesamtcholesterin, gutes HDL-Cholesterin, schlechtes LDL-Cholesterin und Triglyceride im Blut.
Omega-3-Index
Omega-3-Fettsäuren halten in unserem Körper so einiges in Schuss. Sie sind Bestandteile der Zellen, unterstützen einen gesunden Cholesterinspiegel und sind wichtig für Herz und Gehirn. Grund genug, die eigene Versorgungslage näher zu betrachten. Der Bluttest „Omega-3-Index“ von Biogena ist dafür Ihr idealer Partner. Er bestimmt den prozentualen Anteil der beiden Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) im Blut. Mit diesem Parameter lässt sich die Fettsäuren-Versorgung der vergangenen Wochen beurteilen. Ein Index von über 8 % Omega-3-Fettsäuren wird mit einem stark verringerten Risiko für den plötzlichen Herztod und Herzinfarkte in Verbindung gebracht.
Vitamin-D-Status
Vitamin D ist das einzige Vitamin, dessen Versorgung nicht über die Ernährung, sondern in erster Linie über die Sonne erfolgt. Wie gut unser Körper Vitamin D bilden kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab, und so zeigen Untersuchungen, dass die Vitamin-D-Speicher vieler Europäer trotz Eigensynthese leer gefegt sind. Es ist daher sinnvoll, den eigenen Vitamin-D-Spiegel in regelmäßigen Abständen bestimmen zu lassen. Der Bluttest „Vitamin-D-Status“ von Biogena bringt Licht in Ihre aktuelle Versorgungslage.
60 SEKUNDEN WISSEN: Wie kann man Mikronährstoffe messen?